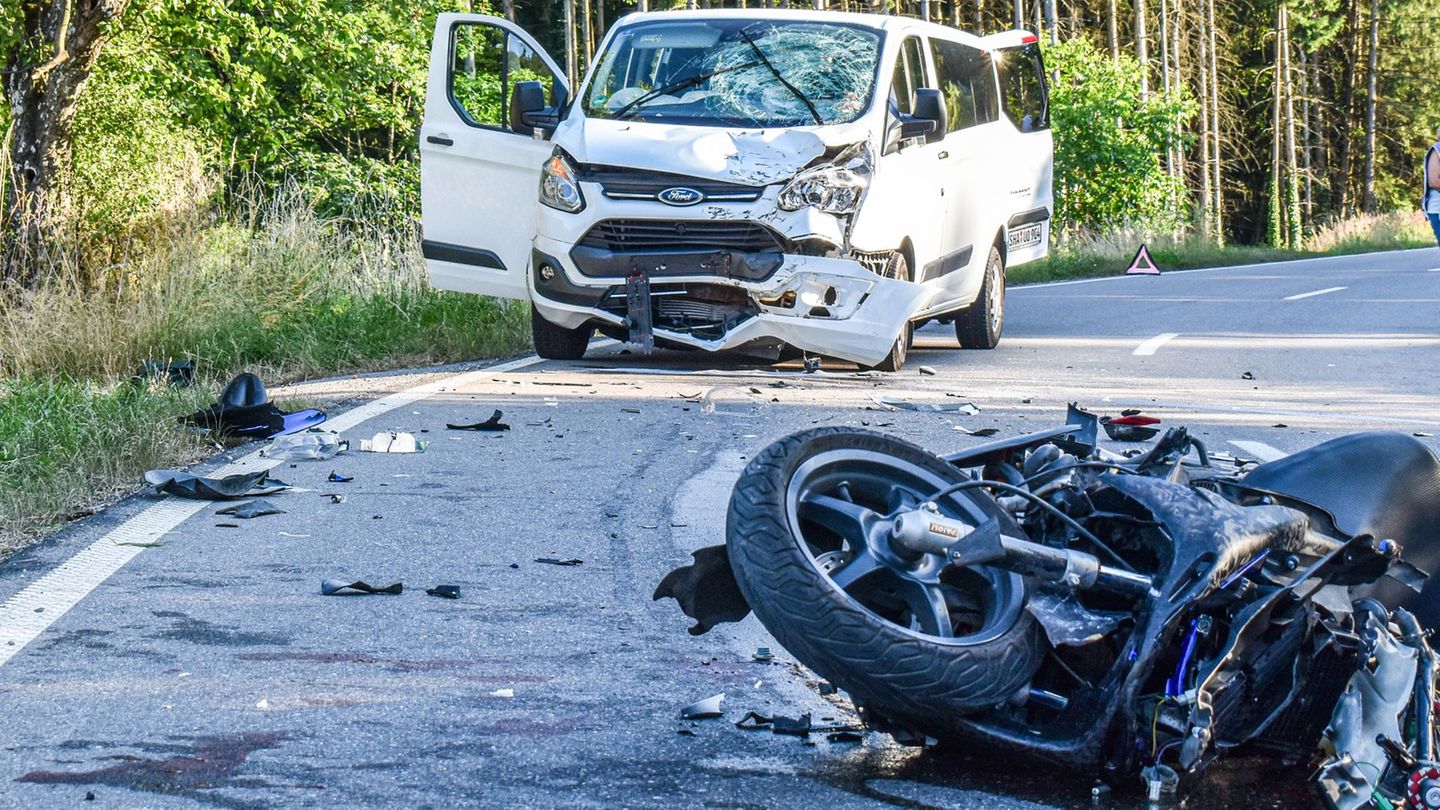Anne Trabant-Haarbach spielte im ersten Frauenteam des DFB. Hier erzählt sie vom Kampf gegen machohafte Funktionäre – und warum sie Waffeln verkaufen musste, um zur WM zu fahren.
Frau Trabant-Haarbach, an diesem Freitag starten die deutschen Fußballerinnen gegen Polen in die Europameisterschaft. Das Stadion ist ausverkauft, die Partie wird live übertragen, es wird mit einem Millionenpublikum gerechnet. Als Sie am 10. November 1982 mit dem Frauen-Nationalteam das erste offizielle Länderspiel der DFB-Geschichte bestritten, waren nur 5000 Leute auf den Tribünen und es gab keine Live-Bilder. Sie sind Sie stolz auf die Entwicklung, die der Fußball seither genommen hat? Oder verbittert, weil Ihnen damals weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde?
Ich sehe es positiv. Die Mädels würden heute nicht eine solch große Bühne bekommen, wenn meine Generation damals nicht gekämpft hätte für den Frauen-Fußball in Deutschland. Ich glaube allerdings, dass viele Spielerinnen gar nicht wissen, wie viele Widerstände wir überwinden mussten in dieser Männerwelt, die der Fußball damals war.
Bis 1970 hatte Frauen-Fußball einen schweren Stand in Deutschland. Der DFB drohte Vereinen mit Sanktionen, sollten sie Frauen-Teams gründen. Wie erklären Sie sich die diskriminierende Gesinnung des DFB?
Im Deutschland der Nachkriegszeit gab es in vielen Teilen der Gesellschaft ein erzkonservatives Rollenverständnis. Fußball war Männersport, ein Revier, das es zu schützen galt vor Frauen. Hermann Neuberger, der Mitte der 70er Jahre DFB-Präsident wurde, sagte sogar öffentlich, dass er Frauen lieber Tennis spielen sieht als ihnen beim Fußball zuzuschauen. Aber davon haben meine Mitspielerinnen und ich uns nicht abschrecken lassen. Unser Ziel war es, die Mauer in den Köpfen der Männer einzureißen.
Sie sind vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren worden. Wie war Ihr Weg zum Fußball, in dem es eigentlich keinen Platz für Sie hätte geben dürfen?
Der WM-Sieg 1954 war ein Schlüsselerlebnis für mich. Bei uns in der Straße hatten sich alle um einen Schwarzweißfernseher versammelt, um das Finale gegen Ungarn zu schauen. Und dann gewinnt unsere Mannschaft das Spiel. Diese Gefühlsexplosion, diese Freude hat mich mitgerissen als kleines Mädchen. Ich wollte das nun auch: etwas tun, was Menschen begeistert.
Ich wollte Fußball spielen wie die Männer im Fernsehen
Und es hat Sie nicht gestört, dass die sogenannten Helden von Bern allesamt Männer waren?
Nein, so geschlechtsspezifisch habe ich das damals nicht wahrgenommen. Ich war emotional angefixt. Ein junges Mädchen, das Fußball spielen wollte wie die Männer im Fernsehen.
Sie sind in Emlichheim aufgewachsen, einer Kleinstadt an der deutsch-niederländischen Grenze. Kannten Sie andere Mädchen, die einen ähnlichen Traum hatten wie Sie?
Ich habe in meiner ganzen Kindheit ausschließlich mit Jungs gekickt. Leider nur auf der Straße und nicht im Verein, beim SC Union Emlichheim. Da durfte ich nur zuschauen. Wenn der Trainer einen besonders guten Tag hatte, ließ er mich mal eine Einheit bei den Jungs mitmachen. Meist aber hieß es: Mädchen haben hier nichts zu suchen!
Was hat Sie durchhalten lassen?
Meine Liebe zum Fußball war lange Zeit größer als mein Frust. Aber als ich 13 oder 14 war, kippte das. Ich war müde. Ich wollte diese ständigen Zurückweisungen nicht mehr ertragen müssen. Ich habe Handball gespielt und mir dort Erfolgserlebnisse geholt.
Meisterlich: Mit dem Bonner SC gewann Trabant-Haarbach (l.) in der Saison 1974/75 den nationalen Titel
© imago sportfotodienst
Wie fanden Sie zurück zum Fußball?
Übers Sportstudium. 1969 habe ich bei einem kleinen Team in Mainz mitgemacht, ein Jahr später bin ich zum TuS Wörrstadt gewechselt, wo das Niveau höher war. In Wörrstadt habe ich auch das Gefühl bekommen, dass es doch noch etwas werden könnte mit dem Fußball und mir. Also dass der Traum, den ich als Mädchen hatte, vielleicht doch wahr wird.
Wir sprechen jetzt über West-Deutschland in den Siebzigern. Wie muss man sich diese Pionierjahre des Frauen-Fußballs vorstellen?
Es gab keine Strukturen, auf die wir hätten zurückgreifen können. Wir mussten alles selbst regeln. Also Spieltermine mit anderen Teams vereinbaren, Schiedsrichter organisieren – und, ganz wichtig: um Trainingszeiten kämpfen. Die Männer hatten immer Vorrang in den Vereinen. Es kam vor, dass wir erst abends ab neun trainieren durften oder auf schlecht beleuchteten Plätzen, weil man das Geld fürs Flutlicht sparen wollte.
Immerhin öffnete sich der DFB und ließ 1974 einen Ligabetrieb zu.
Weil der DFB endlich verstanden hatte: Die Frauen geben nicht auf, die werden wir nicht mehr los.
Die Trägheit des Systems Fußball ist verstörend
Ihre Karriere nahm Fahrt auf in diesen ersten Ligajahren. Sie wechselten zum Bonner SC und danach zur SSG 09 Bergisch Gladbach, wo sie zahlreiche deutsche Meisterschaften errangen. Es gab jetzt zwar überregionale Ligen in Deutschland, aber noch immer keine Frauen-Nationalmannschaft. Warum nicht?
Gleichberechtigung im Fußball ist ein langer, steiniger Weg. Bis heute. Leider müssen wir in Dekaden denken und nicht in Jahren. Weil der DFB sich nur in Zeitlupe bewegte, konnte 1981 zur inoffiziellen WM in Taiwan keine Nationalmannschaft gesandt werden. Der DFB hatte das Einladungsschreiben für die WM an Bergisch-Gladbach weitergeleitet. Dann haben wir uns gesagt: Gut, dann fahren wir eben mit der Vereinsmannschaft zu WM.
Wer hat die Reise bezahlt?
Unser Manager in Bergisch Gladbach ist durch die Region gefahren und hat Gelder von Sponsoren eingesammelt. Wir Spielerinnen haben auch geholfen. Wir haben zum Beispiel Waffeln gebacken und sie dann auf dem Wochenmarkt verkauft. Jede Mark war wichtig.
Klingt wie eine Geschichte aus einem völlig anderen Zeitalter.
Es war absurd. Die Trägheit des Systems Fußball ist verstörend. In anderen gesellschaftlichen Bereichen wie Kunst, Kultur, Wissenschaft und Politik war man in Sachen Gleichberechtigung schon viel weiter in den 80ern. Nur der Fußball war von vorgestern.
Ein TV-Kommentator meinte mal: „Heute ist viel Sex im Spiel.“ Weil wir 6:0 gewonnen hatten
Das betraf auch die Sportberichterstattung. Sie war durchsetzt von sexistischen Anspielungen. Max Merkel etwa schrieb in der Bild-Zeitung: „Die Damen haben sogar einen Vorteil. Der Ball lässt sich mit einer Frauenbrust leichter stoppen.“ Wie haben Sie die Witzchen der Herrengedeck-Republik ausgehalten?
Weghören, und wenn das nicht ging: verdrängen! Es war gar nicht lustig und oftmals einfach nur dümmlich. Ein TV-Kommentator meinte mal: „Heute ist viel Sex im Spiel.“ Weil wir 6:0 gewonnen hatten.
Über die Anfänge des Frauen-Fußballs in Deutschland hat der Journalist Torsten Körner ein Buch geschrieben: „Wir waren Heldinnen“, Kiepenheuer & Witsch, 24 Euro. Von Körner stammt auch die sehenswerte TV-Dokumentation „Mädchen können kein Fußball spielen“, die am 4. Juli um 23:15 Uhr im Ersten gezeigt wird
© Kiepenheuer & Witsch
Beim ersten Länderspiel unter der Regie des DFB im November 1982 führten Sie das deutsche Team an. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen historischen Tag, als es in Koblenz gegen die Schweiz ging?
Ich wurde um 6:00 Uhr von einem Hörfunk-Journalisten aus dem Bett geklingelt, weil er ein Interview für die Morgensendung führen wollte. Vielleicht hätte er besser eine meiner Mitspielerinnen anrufen sollen, denn ich glaube, viele von uns haben gar nicht geschlafen. Wir waren alle sehr nervös. Wir wussten: Heute wird Geschichte geschrieben. Endlich war der Moment gekommen, für den wir so lange gekämpft haben. Wir gewannen 5:1, aber das war nebensächlich. Unser Sieg bestand darin, dass dieses Länderspiel seinen Segen vom DFB bekommen hatte.
Sie beendeten 1983 Ihre aktive Karriere und waren danach noch viele Jahre als Trainerin tätig – unter Bedingungen allerdings, die nicht ansatzweise mit jenen des Männer-Fußballs vergleichbar waren. Wenn Sie zurückblicken auf Ihre Jahrzehnte als Vorkämpferin: Hat Ihnen diese Arbeit mehr Energie gegeben oder geraubt?
Ich werde wohl nie meinen Frieden damit machen, dass die Männer es so viel leichter haben im Fußball als wir Frauen. Aber ich bin glücklich, dass ich Teil einer Bewegung sein durfte, die viel verändert hat im deutschen Sport. Unsere Spielerinnen-Generation hat Geschichte geschrieben. Ich bin jetzt 76 und kann sagen: Es hat sich gelohnt.