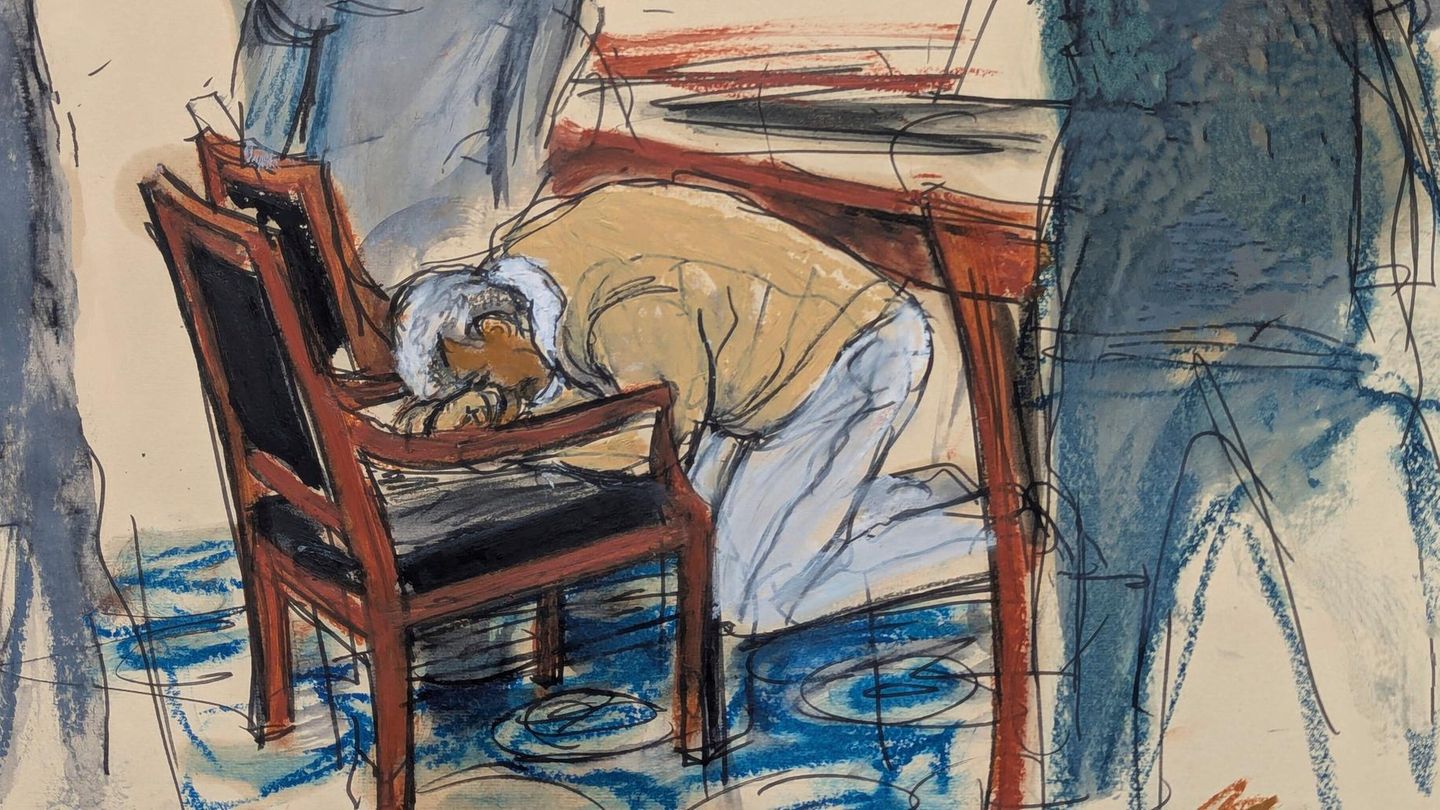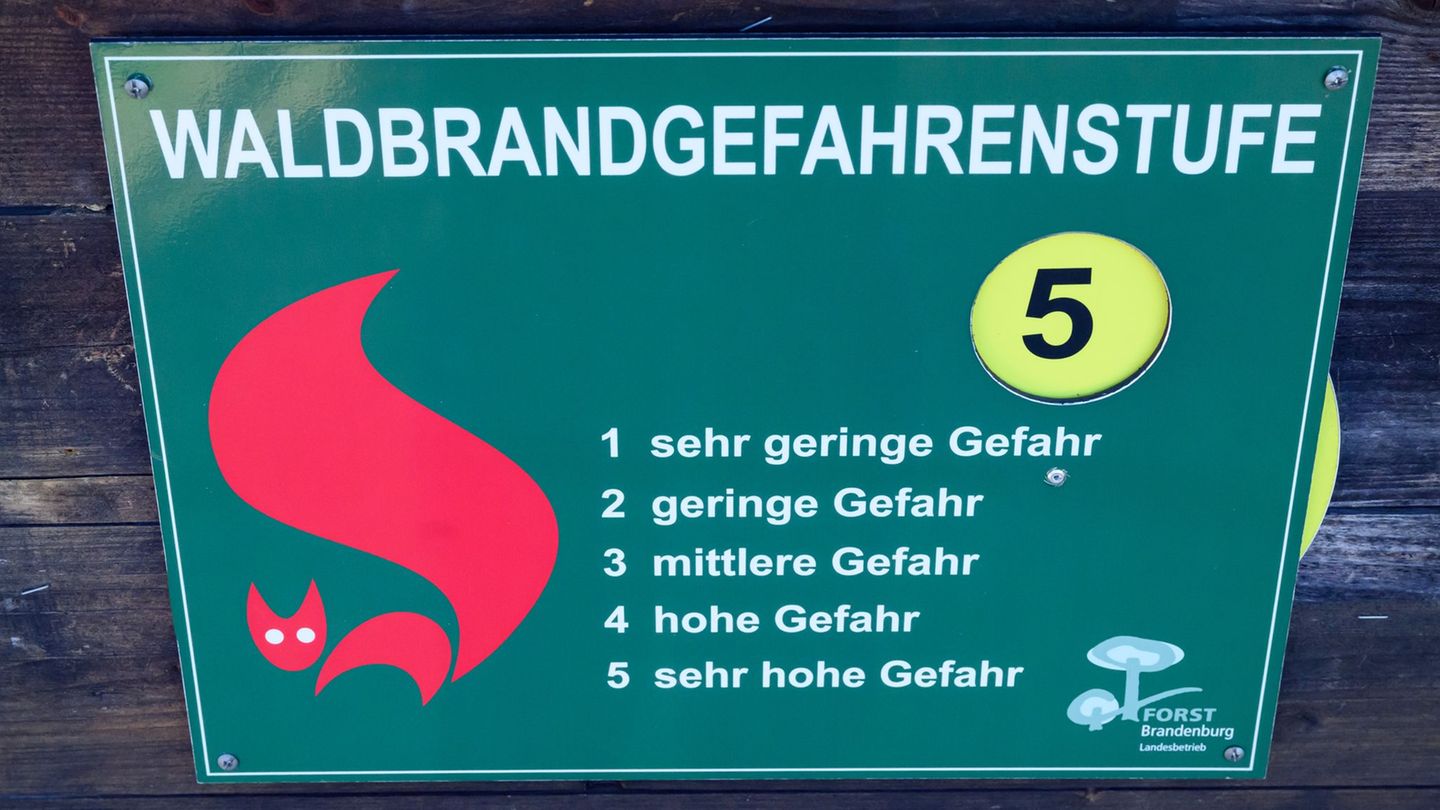Immer wieder landen Erbstreitigkeiten vor Gericht. Meist werden sie zwischen Familienangehörigen ausgetragen. Am Bundesgerichtshof steht hingegen der Hausarzt eines Verstorbenen im Fokus.
Ein kurioser Deal zwischen einem mittlerweile verstorbenen Mann und seinem Hausarzt beschäftigt heute den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Im Gegenzug für dessen medizinische Beratung und Behandlung hatte der Mann seinem Arzt nach seinem Tod ein Grundstück versprochen. Das oberste deutsche Zivilgericht prüft nun, ob diese Vereinbarung rechtmäßig ist.
Im Januar 2016 hatten der spätere Erblasser und der Hausarzt aus Nordrhein-Westfalen vor einem Notar einen „Betreuungs-, Versorgungs- und Erbvertrag“ geschlossen. Der Eine verpflichtete sich darin zu ärztlichen Leistungen wie Hausbesuchen und telefonischer Erreichbarkeit, der Andere sicherte ihm dafür nach seinem Tod das Eigentum an einem ihm gehörenden Grundstück zu. Zwei Jahre später starb der Patient.
Berufsordnung regelt verbotene Geschenke
Als der Hausarzt anschließend insolvent ging, wollte der Insolvenzverwalter das versprochene Grundstück in die Insolvenzmasse übertragen lassen. Vor Gericht konnte er das aber nicht durchsetzen. Das Landgericht Bielefeld wies die Klage ab, die Berufung blieb am Oberlandesgericht Hamm ebenfalls ohne Erfolg.
Das Problem: In der Berufsordnung der zuständigen Ärztekammer Westfalen-Lippe steht, dass Ärztinnen und Ärzte keine Geschenke oder andere Vorteile fordern oder annehmen dürfen, wenn dadurch der Eindruck entsteht, dass ihre ärztliche Unabhängigkeit beeinträchtigt wird. Dagegen habe der Hausarzt mit der Vereinbarung über das Grundstück verstoßen, entschieden die Gerichte. Das Vermächtnis sei daher unwirksam.
Bundesweite Regelung
Die Vorschrift stammt aus der Musterberufsordnung der Bundesärztekammer, die auf dem Deutschen Ärztetag abgestimmt und beschlossen wird. Diese sei zwar an sich nicht bindend, ein Großteil der Landesärztekammern habe die Musterregelung zu den unerlaubten Geschenken aber so oder so ähnlich in der eigenen Berufsordnung umgesetzt, erklärt die Bundesärztekammer.
Die Ärzteschaft habe früh erkannt, dass zwischen ihnen und den Patienten, die sie behandeln, eine ganz besondere Beziehung bestehe, sagt Torsten Münnch, Fachanwalt für Medizinrecht. Schließlich seien erkrankte Patienten abhängig von der ärztlichen Behandlung – und der Erfolg dieser Behandlung wiederum maßgeblich davon abhängig, dass der Patient dem Arzt vertraue. Daher hätten sich die Ärztinnen und Ärzte schon früh selbst ethische Regeln auferlegt.
Der Eindruck zählt
So zum Beispiel die Vorschrift zu Geschenken und Zuwendungen, um die es am Mittwoch in Karlsruhe geht. Wichtig sei, dass es bei dieser Norm nicht darauf ankomme, ob tatsächlich eine Beeinflussung stattfindet, betont Münnch. „Es kommt nur darauf an, ob der Eindruck erweckt wird, dass die Unabhängigkeit der ärztlichen Entscheidung beeinflusst wird“. Mit einem Blumenstrauß sei die Grenze wohl nicht erreicht – „aber hier geht es ja um einen sehr hohen Wert“.
Häufig würden Verstöße gegen die Berufsordnungen der Ärztekammern von den Kammern selbst kontrolliert und geahndet, so Münnch. „Erst wenn die Kammer eine schwerwiegende Maßnahme wie zum Beispiel eine Geldbuße verhängen will, muss sie ein berufsgerichtliches Verfahren einleiten.“ Daher gebe es bisher auch wenige Gerichtsentscheidungen zu dem Thema – die sich zudem meist auf Geschenke der Pharmaindustrie statt von Patienten bezogen.
Besonderheiten des Erbvertrags
Der Fall am BGH weise aber noch eine weitere Besonderheit auf, sagt Münnch. Nämlich, dass das Grundstück im Rahmen eines Erbvertrages versprochen wurde, und nicht etwa im Testament des Patienten. Denn die im Grundgesetz geschützte Testierfreiheit besagt, dass man grundsätzlich auch im Falle seines Todes selbst entscheiden darf, was mit dem eigenen Eigentum passiert. Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte mit Verweis darauf vor zwei Jahren in einem anderen Fall entschieden, dass ein Testament, in dem ein Mann seinem Arzt ein Grundstück vererbte, wirksam ist.
Auf das Frankfurter Urteil habe sich im aktuellen Verfahren auch der klagende Insolvenzverwalter des Hausarztes berufen, so Münnch. „Das Argument zog aber nicht, weil wir hier eben kein Testament haben, sondern einen Vertrag, in dem sich der Patient zu etwas verpflichtet.“ In Karlsruhe zeigt sich nun, ob der BGH die Einschätzung der Vorinstanzen teilt. Ob am Mittwoch schon ein Urteil fällt, ist unklar.