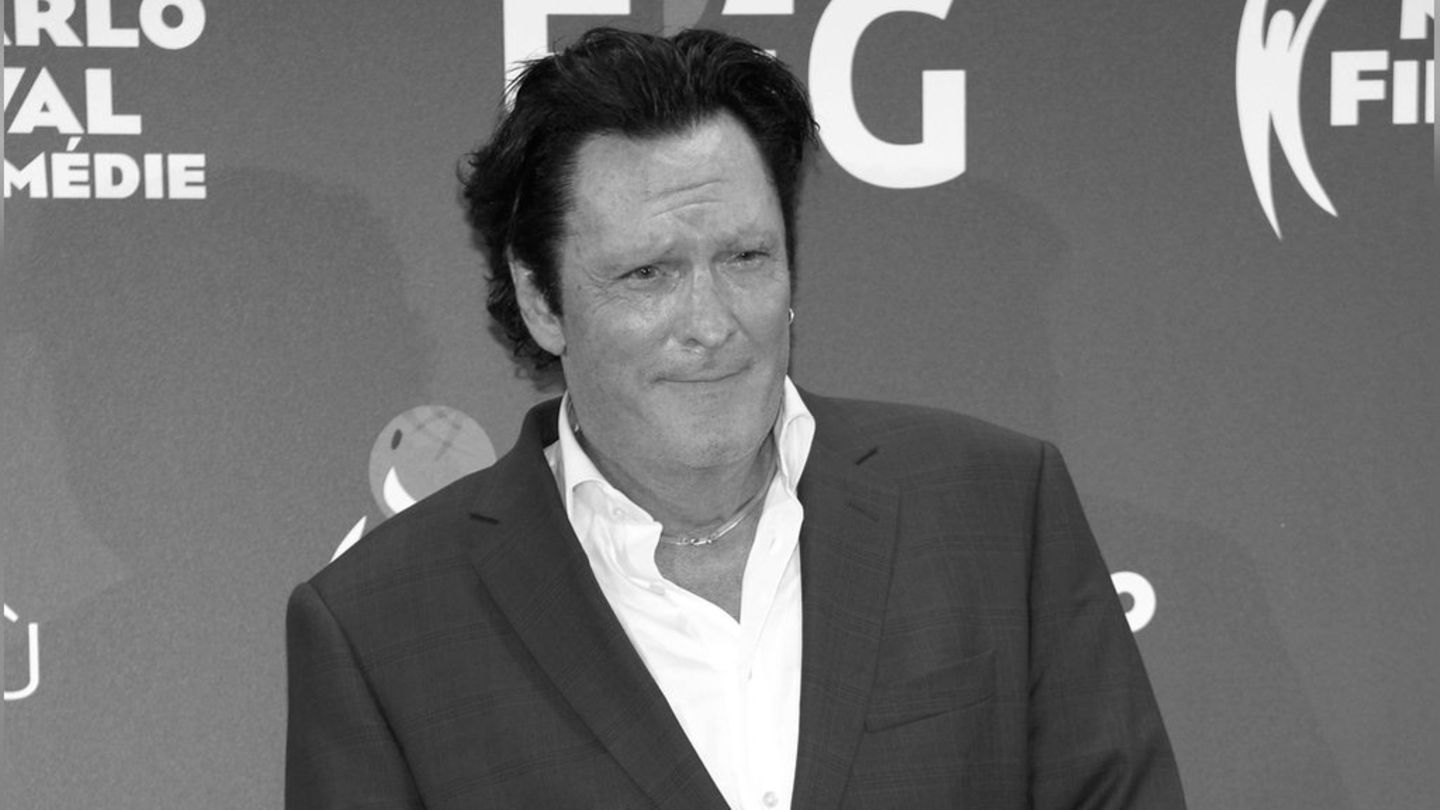Im bisher größten Missbrauchsskandal an einer katholischen Schule in Frankreich hat ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss Premierminister François Bayrou schwere Versäumnisse vorgeworfen. Bayrou sei in seinen früheren Ämtern als Bildungsminister und Vorsitzender eines Regionalrats über die Vorwürfe körperlicher und sexueller Gewalt an der Schule informiert gewesen, habe aber nicht eingegriffen, betonten die Autoren des am Mittwoch veröffentlichten Berichts.
Da Bayrou damals auf ein Eingreifen verzichtet habe, habe es „noch über Jahre hinweg körperliche und sexuelle Übergriffe“ auf Schülerinnen und Schüler der Bétharram-Schule im Südwesten Frankreichs gegeben, heißt es in dem mehr als 300 Seiten langen Bericht des Untersuchungsausschusses.
Einer der beiden Berichterstatter, der linkspopulistische Abgeordnete Paul Vannier, ging noch einen Schritt weiter und warf Bayrou vor, in einer Anhörung vor dem Ausschuss gelogen zu haben. Dies wäre ein Meineid.
Bayrou ist mit der betroffenen Schule am Fuße der Pyrenäen in der Nähe von Pau eng verbunden, drei seiner sechs Kinder besuchten dort den Unterricht. Seine Frau gab dort zeitweise Religionsunterricht. Eine von Bayrous Töchtern erklärte kürzlich, ebenfalls Opfer körperlicher Gewalt gewesen zu sein. Sie habe ihren Eltern damals nichts davon gesagt. Sie warf ihrem Vater aber auch vor, er habe damals die Situation nicht wahrhaben wollen.
In den vergangenen Monaten waren Gewaltvorwürfe von etwa 200 ehemaligen Schülerinnen und Schülern gegen Ordensleute und nicht-geistliches Personal der Bétharram-Schule bekannt geworden. Die meisten Fälle gelten als verjährt. Die Bétharram-Ordensgemeinschaft hatte im März ihre Verantwortung für die Vorfälle eingeräumt und Entschädigungszahlungen in Aussicht gestellt.
Premierminister Bayrou war mehr als fünf Stunden lang von dem Untersuchungsausschuss angehört worden. Dabei wich er von seiner früheren Position ab, „nichts“ von den Vorwürfen gewusst zu haben und räumte ein, dass er „nur aus der Presse“ davon gehört habe.
Der Untersuchungsausschuss machte deutlich, dass Bayrou bereits 1996 über Gewalttaten an der Schule informiert war, als eine erste Anzeige wegen Körperverletzung eingereicht wurde und er selbst einen Bericht in Auftrag gab. 1998 habe er von Vergewaltigungsvorwürfen gegen den ehemaligen Direktor der Einrichtung gewusst.
Die Ausschussmitglieder kritisierten Bayrou zudem für seine Reaktion auf eine frühere Lehrerin, die auf das Gewaltproblem aufmerksam machen wollte. „Die Verwendung des sexistischen Klischees einer ‚hysterischen‘ Frau mit dem Ziel, ihre Aussage zu diskreditieren, ist unerträglich und von Seiten des Premierministers besonders inakzeptabel“, heißt es in dem Bericht.
Die Autoren befassen sich nicht nur mit der Bétharram-Schule am Fuß der Pyrenäen, sondern zeichnen ein erschreckendes Gesamtbild über anhaltende Gewalt gegen Kinder in öffentlichen, besonders aber katholischen Schulen. „Überall in Frankreich sind Kinder monströsen Taten ausgesetzt“, bilanziert die Leiterin des Ausschusses,
„Sexuelle Gewalt im Verborgenen eines Klassenzimmers, im nächtlichen Schweigen in Internaten. Auch körperliche Gewalt, manchmal von unerhörter Brutalität, absolutem Sadismus“, heißt es weiter. Die Bétharram-Schule sei „alles andere als ein Einzelfall“.
Die Kommission fordert, ein ausdrückliches Verbot körperlicher Strafen und Erniedrigungen in das Bildungsgesetz aufzunehmen. In Frankreich ist das Schlagen von Kindern erst seit sechs Jahren gesetzlich verboten. Laut dem Bericht gibt es jedoch „anhaltenden Widerstand gegen das Verbot körperlicher Züchtigungen“. „Gewalt gegen Kinder ist in der französischen Gesellschaft nach wie vor weit verbreitet“, heißt es weiter.
Zu den Empfehlungen der Kommission zählt die Forderung an den Staat, seine Verantwortung anzuerkennen und einen Entschädigungsfonds für die Opfer einzurichten. Gewisse Straftaten gegen Minderjährige sollten von der Verjährung ausgenommen werden. Im Fall von Bétharram waren wegen der Verjährung mehrere Verfahren eingestellt worden – und zahlreiche weitere Vorwürfe werden deswegen keine juristischen Folgen haben.