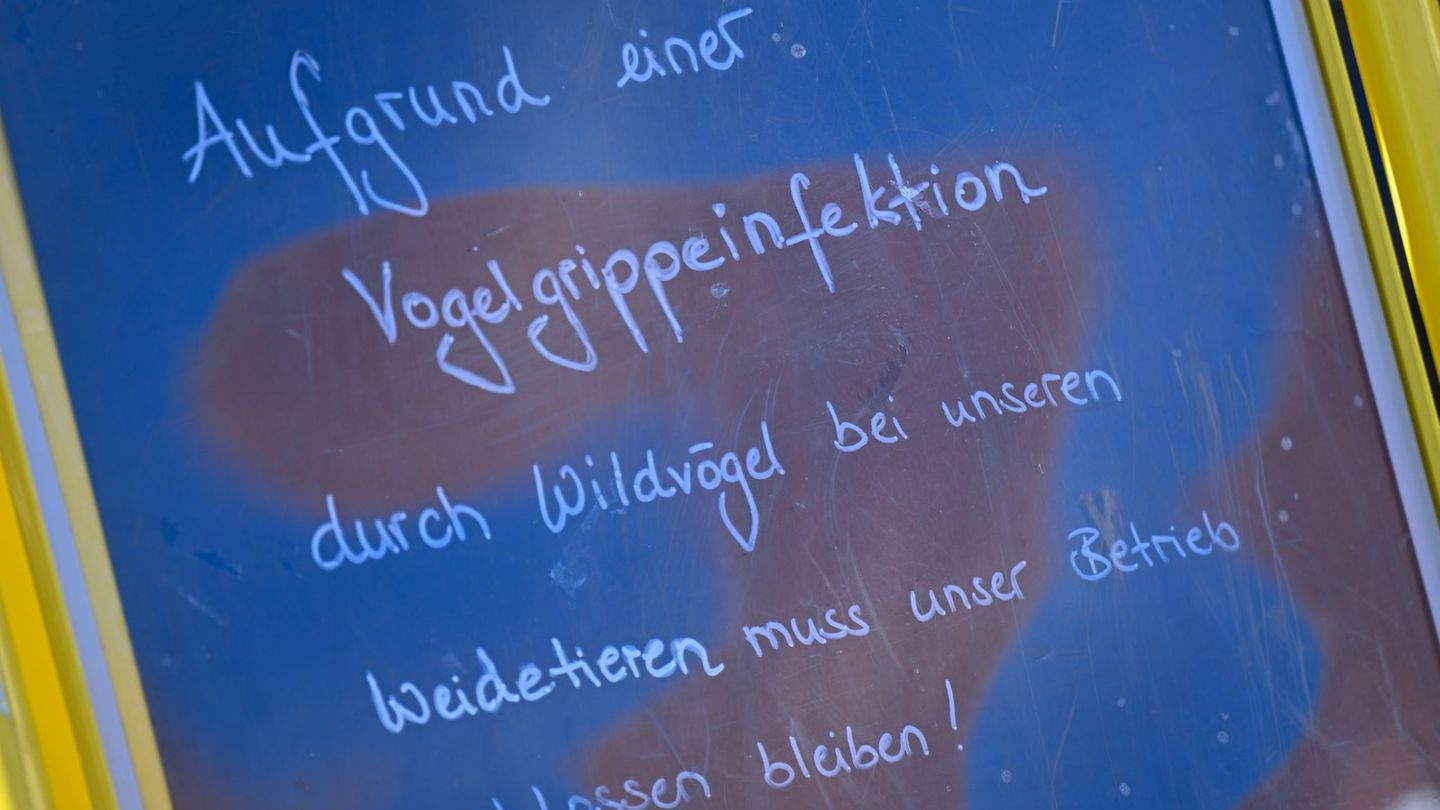Sattel oder Zaumzeug kennen Wildpferde wie die Koniksnicht. Sie galoppieren frei durch Norddeutschland. Wie schaffen sie es alleine in der Wildnis?
Dieser Artikel stammt aus dem Archiv und erschien zuerst im Juli 2022.
Wie kann ein Fohlen bloß so lange Beine haben? Unbeholfen versucht das Neugeborene, sich aufzurichten – und purzelt gleich wieder ins Gras zurück. Seine Mutter, eine stämmige, mausgraue Stute, hat die Geburt ganz allein gemeistert. Weit und breit ist kein Mensch zu sehen – kein Besitzer, der das Fohlen trocken rubbelt, keine Tierärztin, die die Stute untersucht. Nur andere Konik-Pferde nähern sich neugierig und beschnuppern das Fohlen.
Willkommen in der Geltinger Birk, einem Naturschutzgebiet an der Flensburger Förde in Schleswig-Holstein! Hier, zwischen Sümpfen, Wäldern, Dünen und Salzwiesen, dürfen die Tiere frei herumtraben. Vor 20 Jahren wurden erste Koniks im Rahmen eines Naturschutzprojekts in der Birk ausgewildert. Mittlerweile zieht eine Herde von 45 bis 60 Tieren durch die Wildnis. Gemeinsam mit Galloways, Schottischen Hochlandrindern, Schafen und Ziegen haben sie eine wichtige Aufgabe: futtern, was das Zeug hält! Konik-Pferde sind nicht wählerisch. Wenn es kein Gras gibt, zerrupfen sie Schilf, schälen Rinde mit ihren Schneidezähnen von den Bäumen und zermalmen sogar die stacheligen Zweige von Brombeerbüschen.
„Es ist mir ein Rätsel, wie sie das schaffen, ohne sich zu verletzen“, lacht Gisela Vierling. Die ehemalige Tierarztassistentin setzt sich seit Projektbeginn für die Koniks ein. Wenn sie durch das Naturschutzgebiet streift, entdeckt sie immer häufiger seltene Tiere und Pflanzen. Oft kreisen Seeadler am Himmel, staksen Kraniche durchs Nass. Mehr als 200 Vogelarten finden hier halboffene Flächen, die viele von ihnen zum Rasten, Brüten oder Überwintern nutzen. Das ist auch den Koniks zu verdanken – denn sie verhindern, dass Bäume und Büsche das ganze Gebiet überwuchern.
Koniks leben in richtigen Familien zusammen
Das Fohlen ist noch zu klein für Grünzeug. Es saugt Milch bei seiner Mutter – und hüpft anschließend übermütig um seine Tanten herum. Schon die Kleinsten müssen mit der Herde mithalten, denn Koniks sind ständig in Bewegung. Frühmorgens, wenn noch Nebel über den Wiesen hängt, trotten sie oft in das Wäldchen, um sich genüsslich an Bäumen zu scheuern. So pflegen sie ihr Fell, das sie gegen Kälte und Nässe schützt. Tagsüber legt die Herde oft sieben bis acht Kilometer zurück. Die erfahrensten Stuten bestimmen, wann es Zeit zum Aufbruch ist.
Aufbrausend: Konik-Hengste klären in Kämpfen, wer der Stärkere ist. Wiehernd steigen sie auf, treten aus und beißen, bis der Schwächere die Flucht ergreift
© Joe Giddens / PA Wire
„Es ist etwas Besonderes, dass die Koniks bei uns das ganze Jahr über in natürlichen Familien zusammenleben“, sagt Gisela Vierling. Die stärksten Hengste tun sich mit mehreren Stuten zusammen und bekommen mit ihnen Nachwuchs. „Als Väter gehen sie oft richtig liebevoll mit den Fohlen um.“
Die Leithengste der Koniks machen alles, um ihre Familien zu schützen – und würden sich selbst Wölfen entgegenstellen, wenn es sein muss. In der Geltinger Birk lauern diese Raubtiere zwar nicht. Aber wehe, wenn ein jüngerer Hengst probiert, sich mit einer der Stuten zu paaren! Dann greift das Familienoberhaupt ihn an. Die Hengste steigen wiehernd auf und treten und beißen sich, bis der Unterlegene schließlich flieht.
Die grauen Wildpferde haben urzeitliche Vorfahren
Generell verhalten sich Koniks ursprünglicher als zahme Stallponys. Schließlich gelten sie als Nachfahren der letzten Tarpane, Wildpferde, die bis ins 18. Jahrhundert durch die Wälder Osteuropas galoppierten. Später hat man sie in Polen mit Hauspferden gekreuzt und so die Konik-Rasse geschaffen.
Vom Tarpan haben Koniks die unauffällige mausgraue Fellfarbe und den typischen dunklen „Aalstrich“ auf dem Rücken geerbt. Sie sind wachsamer als viele andere Pferderassen und so robust, dass man sie beinahe sich selbst überlassen kann. Trotzdem gehören alle Koniks heute Privatleuten oder Naturschutzeinrichtungen, die aus der Ferne über die Wildpferde wachen. Auch durch die Geltinger Birk wandern täglich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Naturschutzstation, um nach ihnen zu sehen. „Wir begleiten die Koniks, aber wir erziehen sie nicht. Es ist sogar streng verboten, sie zu füttern, damit sie ihr natürliches Verhalten bewahren“, sagt Gisela Vierling. Nur in besonders eisigen Wintern, wenn sie sonst hungern müssten, bekommen die Tiere Heu. Einmal im Jahr werden die wiehernden Wilden außerdem zusammengetrieben.
Familienzuwachs: Konik-Stuten bekommen meist einmal pro Jahr ein Fohlen. Weil die Herde immer in Bewegung ist, muss es sich beim Milchtrinken immer beeilen
© Joe Giddens
Die Fohlen bekommen dann einen Chip unter die Haut verpasst, ganz so wie Hauspferde. Und damit die Herde nicht zu groß wird, werden manche Koniks verkauft. Manchmal siedeln sogar ganze Familien in andere, ähnlich wilde Lebensräume um. Denn in vielen Ecken Europas gibt es immer mehr Naturschutzgebiete, in denen die Landschaftspfleger zum Einsatz kommen. Allein in Deutschland traben geschätzt mindestens 450 Koniks frei umher.
Vielleicht verlässt also auch das Fohlen einmal die Geltinger Birk, wenn es ausgewachsen ist. Aber das wird noch eine Weile dauern. Bis dahin watet es durch Strandseen, lauscht dem Quakkonzert von Laubfröschen und galoppiert mit anderen jungen Koniks um die Wette – zur Freude zahlreicher Besuchsgruppen. Die Koniks sind nämlich eine Attraktion in der Region. Im Sommer und Herbst leitet Gisela Vierling spezielle Wildpferdeführungen. „Manchmal hat die Herde keine Lust auf uns und stürmt davon“, erzählt sie. „Aber meist kann man sich behutsam nähern und den Tieren ganz in Ruhe zuschauen!“